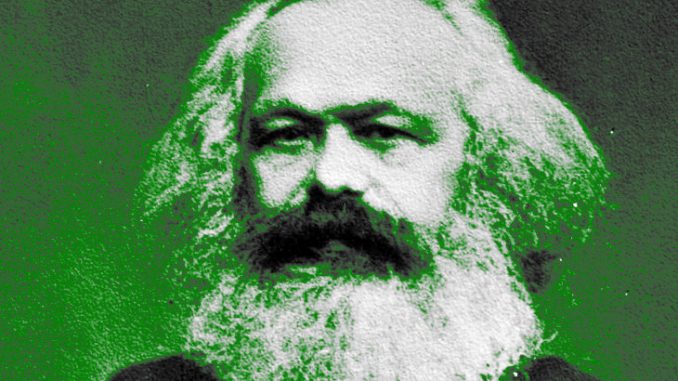
Nachdruck aus der »Arbeiterstimme«, Nr. 209, 2020
In der letzten ARSTI (Nr. 208) haben wir uns mit der Degrowth Bewegung auseinandergesetzt. Im folgenden Beitrag sollen einige Aspekte, die grundsätzliche Fragen aufwerfen und wichtig für die Diskussion sind, nochmals aufgegriffen werden. Es geht dabei zwar auch darum Degrowth Positionen zu kritisieren, aber nicht nur darum. Ziel ist es auch, die eigenen Analysen und Vorstellungen zum Themenkomplex Ökologie, Postwachstum etc. zu überprüfen, zu konkretisieren und zu schärfen.
Historisch gesehen spielen Ökologie und (eventuelle) Grenzen des Wachstums für die meisten Menschen noch nicht sehr lange eine wichtige Rolle, vermutlich erst seit entsprechende Probleme immer offensichtlicher in der Realität erkennbar werden. Der Zeitpunkt, seit wann das der Fall ist, lässt sich nicht so ohne weiteres bestimmen, je nachdem ob man sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, populäre Veröffentlichungen mit großer Breitenwirkung oder den Beginn von einschlägigen Bewegungen bezieht. Als Initialzündung der Umweltdebatte wird oft das Buch „Der stille Frühling“ (1962) von Rachel Carson, über die weitverbreiteten Rückstände des Insektengifts DDT in der Umwelt, angesehen. Ein besonders einflussreicher Beitrag war ohne Zweifel der 1. Bericht an den Club of Rome über die Grenzen des Wachstums (1972). In Deutschland formierte sich ab 1974 Widerstand gegen den Bau des Atomkraftwerk Wyhl. Das war der Beginn der anti Atomkraft Bewegung.
Seitdem hat sich eine breite Diskussion etabliert, es ging und geht über die Nutzung der Atomkraft, Energieverbrauch und Ressourcenverbrauch ganz allgemein, Umweltbelastungen aller Art, Sinn und Unsinn von Wirtschaftswachstum, Waldsterben, Artensterben und Biodiversität, Ozonloch, Trinkwassermangel, Plastikmüll und andere Themen. Dabei hat sich der Schwerpunkt der Diskussionen immer wieder verschoben. So ist das heute eindeutig in Mittelpunkt stehende Thema, der Klimawandel verursacht durch die CO2 Freisetzung, erst gegen Ende der 70ger Jahre als relevant erkannt worden (z.B. Charney Report von 1979) und seit Mitte der 80ger Jahre allmählich in das allgemeine Bewusstsein eingedrungen. 1992 war dann der erste „Klimagipfel“ in Rio de Janeiro.
Stoffwechsel von Mensch und Natur
Neben ökonomischen und sozialen Fragen sind damit Aspekte „des Stoffwechsels von Mensch und Natur“, wie Marx das genannt hat, zu einem wichtigen politischen Thema geworden. Es gibt keinen Zweifel, dieser Stoffwechsel findet zu Beginn des 21 Jahrhunderts in einer Weise statt, die alarmierend ist. Der Mensch, oder besser gesagt die vorherrschende Produktions- und Lebensweise, ist dabei, die natürliche Basis der eigenen Existenz nach und nach zu zerstören. Die Thematisierung und Politisierung des Stoffwechsels mit der Natur kann als Veränderung von historischer Bedeutung angesehen werden. Das Thema wird und muss auf der Tagesordnung bleiben und wird jede zukünftige Entwicklung erheblich beeinflussen.
Der Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur hat sich über lange Zeit weitgehend urwüchsig und unhinterfragt gemäß den vorherrschenden gesellschaftlichen, sprich kapitalistischen, Bedingungen entwickelt. Als die Öffentlichkeit begann solche Fragen verstärkt zu diskutieren, geschah dies vor dem Hintergrund einer bereits seit Jahrhunderten stattfindenden kapitalistischen Praxis. Einer Praxis, die selbst ständig Änderungen unterworfen war und ist, gemäß der dynamischen Natur des Kapitalismus und entsprechend der verschiedenen Phasen der kapitalistischen Entwicklung. Weil sie über lange Zeit weitgehend unangefochten dominierte, hat sich diese kapitalistische Praxis als der scheinbar „normale“ Umgang der Menschen mit der Natur etabliert. Für das Bewusstsein der Gesellschaft war und ist das typisch kapitalistische nicht mehr direkt erkenntlich. Nun ist die kapitalistische Praxis, den Stoffwechsel mit der Natur zu organisieren, nicht darauf angelegt schonend mit der Natur umzugehen. Marx hat das so ausgedrückt: „ Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (MEW 23, 530)
Wachstumszwang gegen Gebrauchswertorientierung
Die Degrowth Szene nimmt für sich in Anspruch, mit dem Zwang zum Wirtschaftswachstum, dem Wachstumsparadigma, den Kern des Problems, die Ursache für das destruktive Vorgehen, identifiziert zu haben.
Zum Wesen des Kapitalismus gehört Kapitalakkumulation. Kapital muss sich verwerten. Geld wird investiert, um mehr Geld zu erwirtschaften. Für den erzielten Profit wird nach einer profitablen Wieder-Anlagemöglichkeit gesucht und damit beginnt der Verwertungszyklus vom neuen, auf erweiterter Basis. Die Kapitalakkumulation ist ihrem Wesen nach unbegrenzt. Sie ist notwendigerweise mit wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden, die einem immer höheren monetären Gegenwert entsprechen. Historisch war das auch immer mit einer Ausdehnung der materiellen, stofflichen Produktion verknüpft. Eine Entkoppelung von Kapitalakkumulation (und damit Wachstum ausgedrückt in Werten) und der materiellen Produktion (mit entsprechenden Ressourcenverbrauch) ist zur Zeit nicht sichtbar. Es ist fraglich, ob eine Entkoppelung überhaupt möglich ist.
Deshalb treffen die Degrowth Befürworter_innen einen wichtigen Punkt, wenn sie einen Wachstumszwang feststellen und daran gekoppelt, einen Zwang zur Ausdehnung der Warenproduktion und zu immer größeren Ressourcenverbrauch. Woran es aber in der Degrowth Argumentation oft mangelt, ist die eindeutige Benennung der Ursache für den Wachstumszwang. Es ist eben nicht der grenzenlose Konsum, die Struktur der Industrie, die Gier der Menschen oder dergleichen, sondern der Zwang zur Kapitalakkumulation und damit ein Wesenskern des Kapitalismus, der als eigentliche Ursache des Wachstumsparadigma identifiziert werden muss. Damit ist klar, eine grundsätzliche Lösung wird erst durch Beendigung des Zwangs zur Kapitalakkumulation möglich sein. Bis dahin sind nur punktuelle Lösungen möglich, die negative Folgen mehr oder weniger effektiv eingrenzen. Der Bestand solcher Erfolge wird allerdings durch die der Akkumulation eigenen Dynamik, ständig wieder in Frage gestellt.
Noch viel weiter verbreitet sind in der Degrowth Szene unklare Positionen bei der notwendigen Unterscheidung von Gebrauchswert und Tauschwert (oder kurz Wert). Der dem Kapitalismus inhärente Wachstumszwang bezieht sich nicht auf Gebrauchswerte, also der Nutzen von produzierten Waren für die Menschen, sondern auf die Tauschwerte. Immer größere Summen an Werten müssen produziert und realisiert werden, um die Akkumulation voranzubringen. Die Gebrauchswerte der Waren sind dabei letztlich nebensächlich, ebenso wie die Frage ob der Produktionsprozess von schädlichen Nebenwirkungen begleitet ist, die eventuell den Nutzen eines Gebrauchswert übertreffen. Die innere Logik der Steuerung des gesamten Prozesses bezieht sich auf die Kriterien Wert, Kosten, Profit.
Eine bewusst auf Nachhaltigkeit ausgelegte Organisation des Stoffwechsels mit der Natur müsste strikt auf die Produktion von Gebrauchswerten ausgerichtet sein. Nur so kann der Nutzen für die Menschen, die benötigten Ressourcen und der Schaden, der eventuell durch die Produktion direkt und indirekt angerichtet wird, sinnvoll aufeinander bezogen werden. Entsprechende Bilanzierungssysteme, die vermutlich sehr komplex wären, müssten entwickelt und umfassend eingesetzt werden. Die entscheidenden Kriterien, die die Produktion steuern, wäre dann nicht mehr die finanzielle Bilanz, also der Gewinn, sondern eine Nutzen-Schaden Bilanz. Nur auf einem solchen Weg ließe sich eine Basis für einen Stoffwechsel Mensch Natur erreichen, der die Natur nicht als beliebig nutzbar und verwendbar voraussetzt.
Es ist offensichtlich, dass eine solche Umstellung der Produktion das Aufheben der kapitalistischen Logik voraussetzt. Eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse (Sozialisierung) wäre dabei eine Voraussetzung, aber keineswegs gleichbedeutend mit der konsequenten Gebrauchswertorientierung. Diese ist vermutlich nur in einem längeren Umstellungsprozess erreichbar. Ein Umstellungsprozess, der die genannte Nutzen-Schaden Bilanzierung konkret umsetzt, Ressourcen schonende Verfahren einführt und ein weitgehendes Recycling etabliert. Es wäre eine Illusion, die Gebrauchswertorientierung für eine einfache Sache zu halten, die ohne Konflikte abläuft. Denn selbstverständlich gibt es auch in einer postkapitalistischen Gesellschaft noch unterschiedliche Interessen und verschiedene Prioritäten.
Zugegeben, das Aufheben der kapitalistischen Logik ist kein leichtes Ziel und aus heutiger Sicht ist nicht absehbar, wie und wann es erreicht werden könnte. Aber es bringt nichts, das im Unklaren zu lassen. Illusionen helfen nicht weiter. Selbstverständlich ist es sinnvoll und notwendig, realistische Zwischenziele anzustreben und dafür zu kämpfen. Aber Zwischenziele sollten als solche benannt werden und idealerweise in einer langfristigen Strategie eingebettet sein.
Nur wenn der Gebrauchswert von Produkten den negativen Folgen ihrer Produktion entgegengestellt wird, kann eine rationale Diskussion darüber geführt werden, ob eine Steigerung der Produktion, also Wachstum im Sinne von mehr Gebrauchswerten, sinnvoll und zu verantworten ist. Das Ergebnis einer solchen Analyse muss nicht unbedingt die Unmöglichkeit von weiteren Zuwächsen bedeuten. An dieser Kritik bezüglich eines proklamierten definitiven Ende jedes Wachstum ist festzuhalten und sie ist nicht mit einem naiven Wachstumsoptimismus zu verwechseln. Die Vorstellung, die von verschiedenen Autoren geäußert wird, dass sich arme und reiche Länder etwa auf mittleren Niveau im Bezug zur jetzigen Stufe ihrer Wirtschaftsleistung treffen sollten, ist bei nüchterner Betrachtung willkürlich. Sie erscheint eher durch, spontan vielleicht einleuchtende, Gerechtigkeits- und Solidaritätsvorstellungen begründet zu sein als von hinreichenden genauen Analysen des stofflichen Austausch mit der Natur.
Industrialismus und Produktivkraftentfaltung
Aus der Degrowth Szene kommt, bei Teilen der Bewegung, Kritik am sogenannten Industrialismus, worunter die Gesamtstruktur einer auf mechanisierter Arbeit beruhenden Industriegesellschaft verstanden wird. Die Kritiker_innen identifizieren den Industrialismus als die oder eine der tiefen Ursachen der Probleme. Ein erster Einwand dagegen bezieht sich auf die Tatsache, dass die Kritiker_innen es versäumen, sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen, was die Alternativen zum Industrialismus wären. Auf welche Stufe der Produktivkraftentfaltung soll denn zurückgegangen werden, wenn man vom Industrialismus wegkommen will. Wann ist eine Produktionsweise kein Industrialismus mehr? Nach welchen Kriterien wird das entschieden? Was wäre das genaue Ziel? Eine Gesellschaft mit Subsistenzlandwirtschaft, kombiniert mit der handwerklicher Produktion von einigen sonstigen Waren? Bei manchen Autoren hört sich das so an, als wäre das die bevorzugte Utopie. Aber eine genaue Aussage findet man praktisch nie und sicher gibt es dazu auch keinen Konsens in der Szene.
Ein großer und prinzipieller Dissens ist bei der Einschätzung der Produktivkraftentwicklung festzustellen. Viele Wachstumskritiker_innen lehnen diese grundsätzlich ab. Mit dieser Ablehnung bleiben sie an der gegenwärtigen gesellschaftlichen Bestimmung der Produktivkraft und der Technik stehen. Eine Produktivkraftentwicklung, die gezielt auf die Steigerung der Gebrauchswerte und gleichzeitig auch auf den Erhalt der Natur zielt, können sie sich anscheinend nicht vorstellen. Das Ziel und der Zweck einer weiteren Produktivkraftentfaltung muss ja keineswegs die Produktion von immer mehr Waren sein, sondern könnte auch die radikale Verkürzung der für den Lebensunterhalt notwendigen Arbeitszeit ermöglichen. Eine Forderung, die ja auch von vielen Degrowth Anhänger_innen geteilt wird. Produktivkraftentwicklung muss nicht mit einer Steigerung des Drucks und größerer Belastung für die Arbeitenden verbunden sein, sondern könnte auch die Basis für genau das Gegenteil sein. Es käme auf den angestrebten Zweck an und wer, unter welchen Bedingungen über die Umsetzung entscheidet. Sicher gibt es so etwas noch nicht, aber es gibt ja auch noch keine postkapitalistische oder sozialistische Gesellschaft, die sich das zum Ziel gesetzt hat und entschlossen darauf hinarbeitet.
Technik ist nicht neutral ! Diesem oft vorgebrachten Satz ist grundsätzlich zuzustimmen. Denn Technik wird nicht in einer neutralen Reinform realisiert, sondern immer im konkreten gesellschaftlichen Zusammenhängen. Die realisierte Technik enthält also neben den zu einer gegebenen Zeit technischen Möglichkeiten, dem Stand der Technik, auch immer durch die Gesellschaft gesetzte Zwecke. Konkret gesprochen. Technik im Kapitalismus enthält auch kapitalistische Zwecke. Auch der „Stand der Technik“ ist nicht neutral. Denn was und wie intensiv erforscht und entwickelt wird, ist selbstverständlich entscheidend abhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen. Ganz direkt durch die Bereitstellung oder auch nicht Bereitstellung von finanziellen Mitteln, indirekt durch den Stand des allgemeinen Bewusstsein zu den Problemen und Zielen einer Gesellschaft. Auch der Wissenschaftler, der formal frei über einen gewissen Forschungsetat verfügen kann, entscheidet nicht unabhängig von der Gesellschaft, in die er eingebunden ist.
Die Konsequenz für eine nachkapitalistische Gesellschaft ist deshalb nicht, auf Technik zu verzichten, sondern eine neue Technik gemäß ihren eigenen Bedingungen und Zwecken zu entwickeln bzw. vorhandene Techniken entsprechend umzugestalten. Dass eine solche Ablösung der industriellen Struktur von der Profitlogik nicht einfach ist, ist sicher auch richtig. Genauso wie bei der Gebrauchswertorientierung wäre es eine Illusion zu glauben, mit einer Veränderung der Eigentumsverhältnisse würde ein solcher Schritt quasi automatisch mitvollzogen.
Der bei einer solchen Argumentation regelmäßig erfolgende Verweis auf die sogenannten realsozialistischen Ländern, die eben auch keine nachhaltige Technik entwickeltet hätten, ist nicht stichhaltig. Nicht weil an der Tatsache, dass dies nicht geschehen ist, zu zweifeln wäre. Sondern weil festzustellen ist, dass dieses überhaupt nicht als dringliche Aufgabe erkannt worden ist. Es war immer das, bei allen sonstigen Differenzen im kommunistischen/sozialistischen Lager, mit großem Konsens angestrebte und auch offen benannte Ziel, die kapitalistische Welt bezüglich der Produktionskapazitäten möglichst schnell einzuholen und zu überholen. Ein weiterer Grund war die anfängliche technologische Unterlegenheit, die eine weitgehende Kopie der kapitalistischen Produktionsmethoden als den schnellsten und effektivsten Weg erscheinen ließ. Nachahmen ist einfacher als neu entwickeln.
Es ist ja richtig. Trotz der gelegentlichen Anmerkungen von Marx zum Verhältnis zur Natur, die aus heutiger Sicht erstaunlich hellsichtig sind1, waren die Marxisten in ihrer bisherigen Geschichte auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet. Ökologische Fragen spielten lange Zeit kaum eine Rolle. Das trifft nicht nur bei den sogenannten realsozialistischen Ländern zu, sondern bei Marxisten allgemein, auch bei Marxisten aus kritischen und in Opposition zur Hauptrichtung stehenden Strömungen, genauso wie auf andere, aus der Arbeiterbewegung hervorgegangene nicht (mehr) marxistischen Bewegungen, wie die Sozialdemokratie oder auch viele Gewerkschaften.
Wenn man den sozialistischen Ländern (und den Marxisten) also etwas vorwerfen kann, dann das, dass sie der historischen Entwicklung nicht voraus waren und nicht früher die ökologische Problematik erkannt haben. Dieser Vorwurf hat insofern eine gewisse Berechtigung, als etliche Marxisten/Kommunisten versucht haben, den Eindruck zu erwecken, sie und nur sie würden die Bewegungsgesetze der Gesellschaft umfassend verstehen.
In Wirklichkeit wurde die Bedeutung der ökologische Fragen von den Marxisten nicht früher erkannt als von Nichtmarxisten. Im Gegenteil, es gab viele (auch ganze Parteien), die Probleme hatten, die Relevanz der neuen Themen wahrzunehmen und anzuerkennen. Sie waren also ihrer Zeit nicht voraus, standen nicht an der Spitze der Diskussion, sondern hinkten ihr hinterher. Das soll nicht verleugnet, sondern selbstkritisch hinterfragt werden.
Externalisieren, eine Methode Kosten abzuwälzen und Auflagen zu umgehen.
Das Externalisieren spielt eine prominente Rolle in der Postwachstum Literatur. Insbesondere Stephan Lessenich thematisiert es in seinem Buch „Neben uns die Sintflut“ ausführlich. Er stellt es als besonders typisch für die gegenwärtigen Verhältnisse dar. Externalisierungen sind aus seiner Sicht geradezu der Schlüsselbegriff zum Verständnis des globalen Kapitalismus.
Externalisieren bedeutet etwa „nach Außen verlagern“ oder „sich nicht darum kümmern“. So verfährt man mit allem, was Kosten verursacht oder sonst wie Probleme bereitet. Die Möglichkeit des Externalisieren ist von Anfang an in der kapitalistischen Produktionsweise angelegt. Jeder Einzelbetrieb geht von einer betriebswirtschaftlichen und nicht einer gesamtwirtschaftlichen Rechnung aus. Nur was in der betriebswirtschaftlichen Rechnung auftaucht, z.B. als Kosten, ist für den Einzelbetrieb auch relevant. Was kostenlos zur Verfügung steht (Luft, eventuell Wasser) oder erst nach dem Verkauf der Waren zum Problem wird (Verpackungsmüll, Elektroschrott), dessen simple Entsorgung geduldet wird (Abluft, Abwasser, Lärm), wird zuerst einmal nicht beachtet. Es wird genutzt oder sonst wie in Anspruch genommen, ohne sich um die Folgeprobleme zu kümmern oder sich an anfallenden Kosten zu beteiligen. Diese werden gerne der Gesellschaft aufgebürdet. Nur wenn die Gesellschaft, meistens als Staat, dieser Vorgehensweise Grenzen setzt, entsprechende Gesetze bzw. technische Vorschriften erlässt, spezielle Abgaben erhebt etc., tauchen die dazugehörigen Kosten dort auf, wo sie nach dem Verursacherprinzip hingehören, nämlich in der betriebswirtschaftlichen Rechnung, sie werden dadurch internalisiert. Selbstverständlich muss die Einhaltung von Regeln dauernd kontrolliert und unter Strafandrohung auch durchgesetzt werden. Die Konkurrenz zwingt die Einzelbetriebe dazu, die Kosten möglichst gering zu halten. Deshalb besteht ein ständiger Anreiz, solche auferlegte Internalisierungen auf irgendeinen Weg wieder loszuwerden, Auflagen zu umgehen, Kosten und negative Folgen anders wohin zu verlagern, also zu externalisieren.
Durch die Globalisierung haben sich neue und erhebliche Möglichkeiten zur Externalisierung aufgetan. Das gilt nicht nur für international tätige Firmen, sondern kann auch durch das Ausnutzen einer entsprechenden internationalen Arbeitsteilung erreicht werden. Durch die unterschiedlichen Entwicklungsstände der Staaten gibt es vielfältige Möglichkeiten einzelne Produktionsschritte, die mit problematischen Begleiterscheinungen verbunden sind, sei es aus ökologischen, sozialen oder arbeitsrechtlichen Gründen, in Länder zu verlagern, wo mit wenig oder keinen einschränkenden Bedingungen zu rechnen ist. Zum Teil ergeben sich solche Organisationsformen urwüchsig durch die Konkurrenz der Akteure, zum Teil sind sie auch bewusst geplant. Potentielle Gegenbewegungen sind damit konfrontiert, dass durch die räumliche Verlagerung die Probleme im einen Land nicht mehr direkt sichtbar sind und somit aus dem Focus verschwinden und das zweite Land genau deswegen ausgewählt wurde, weil dort, aus welchen Gründen auch immer, eine wirksame Gegenwehr nicht zu erwarten ist.
Es ist unstrittig, Externalisierungen finden in erheblichen Ausmaß statt, und dadurch werden Kosten, Schäden und Nutzen ungleich verteilt. Insbesondere international agierende Konzerne nutzen dieses Mittel. Sie verschaffen sich dadurch Vorteile gegenüber der Konkurrenz bzw. maximieren ihre Profite. Wie oben festgestellt sind der Anreiz zur Externalisierung in der kapitalistischen Produktionsweise angelegt. Deshalb besteht auch permanent die Situation, dass bereits durchgesetzte Auflagen durch neue Varianten der Externalisierungen wieder in Frage gestellt werden, wenn schon nicht legal so zumindest real. Durch die Externalisierungen wird auch sichtbar, wie dringend notwendig eine international koordinierte Gegenwehr, z.B. durch Gewerkschaften, wäre.
Zugriff auf die Natur, Ausbeutung der Natur
Die Rede von der Ausbeutung der Natur ist weit verbreitet. Mit diesem Etikett können unterschiedliche Sachverhalte versehen werden, so z.B. die Überfischung der Meere, die Massentierhaltung oder die Rodung von naturnahem Regenwald zur Gewinnung von kommerziell nutzbaren Flächen, etwa als Weideland oder für Palmölplantagen. Des weiteren ist mit Ausbeutung der Natur die Gewinnung von Rohstoffen gemeint. Zum Rohstoffabbau sollen im folgenden die relevanten kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten näher betrachtet werden.
Der Wert von Waren bemisst sich im Kapitalismus nach der darin enthaltenen Arbeitszeit. Dies gilt auch für Rohstoffe. Wasser und besonders Luft waren (oder sind) oft ohne Arbeitsaufwand zugänglich. Insofern besitzen sie keinen Wert. Rohstoffe wie Erze, Kohle, Erdöl, Mineralien etc. finden sich in der Natur, sie werden also (im engeren Sinne) nicht produziert. Deshalb haben sie auch keinen Wert an sich, wie alles was in der Natur ohne verausgabte Arbeit vorhanden ist. Allerdings ist Arbeitskraft notwendig, um Lagerstätten zu finden, die Rohstoffe aus der Erde zu hohlen, sie gegebenenfalls vorzubehandeln, z.B. den Erzanteil anzureichen, und sie dann dorthin zu transportieren, wo sie gebraucht werden. In der Realität kann das relativ einfach sein (z.B. bei Sand und Kies) oder sehr kompliziert, verbunden mit dem Einsatz von viel Technik und Kapital. Entsprechend dem Aufwand bei der Förderung, kommt dem Rohstoff ein mehr oder weniger großer Tauschwert zu, der die Basis für die Preisfindung des Rohstoffs ist. Was durch den Abbau sonst noch bewirkt wird, ob die Landschaft verwüstet, Wasser verschmutzt wird etc. ist erst einmal nicht für die Kalkulation relevant. Auflagen, die solches begrenzen sollen, müssen von Außen festgelegt und durchgesetzt werden. Durch Auflagen bedingte Aufwendungen erhöhen die Kostpreise.
Normalerweise fordert auch der Eigentümer des Grund und Bodens, auf dem der Rohstoff lagert, eine Vergütung für die Fördererlaubnis (solche Abgaben werden oft auch Royaltys genannt). Diese Vergütung, eine spezielle Art der Grundrente, geht ebenso in den Rohstoffpreis ein. Es liegt in der Natur der Sache, dass zuerst die Lagerstätten ausgebeutet werden, die einfach und kostengünstig zu erschließen sind. Nach deren Erschöpfung bzw. bei großer Nachfrage werden auch schwieriger und zu höheren Kosten abzubauenden Lagerstätten erschlossen. Für die Preisfindung eines Rohstoffs sind dabei die Kosten der jeweils ungünstigsten Fördergebiete, die noch benötigt werden, um die Nachfrage zu befriedigen, maßgeblich. Alle Anbieter, die günstiger fördern können, erzielen einen Extraprofit. Die Seltenheit eines Rohstoff spielt dabei nur insofern eine Rolle, als diese den Aufwand zu seiner Auffindung und Gewinnung beeinflusst. Eine sich eventuell abzeichnende Erschöpfung von Lagerstätten in der Zukunft, muss nicht unbedingt für die aktuellen Fördermengen und Preise relevant sein. Das ändert sich erst, wenn die Förderung effektiv eingeschränkt werden muss.
Der Kapitalismus setzt die Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen für seine Zwecke als selbstverständlich voraus. Die einzige in der kapitalistischen Logik vorgesehene Grenze für die Verfügbarkeit, ist das Eigentum. Nur der Eigentümer von natürlichen Ressourcen hat das Recht, die Verfügbarkeit einzuschränken. Aus diesem Recht erklärt sich auch die Grundrente. Die Eigentumsverhältnisse an Rohstoffen sind in den einzelnen Staaten unterschiedlich geregelt. Häufig ist der Staat grundsätzlich der Eigentümer von Bodenschätzen. In einem solchen Fall bezieht auch der Staat die Royaltys. Die Höhe der Grundrente wird letztlich durch die Konkurrenz der Grundeigentümer bzw. Staaten, die über einen gegebenen Rohstoff verfügen können, bestimmt. Die Erfahrung zeigt, dass in den meisten Fällen die Konkurrenz genügend groß ist, um die Royaltys eher gering zu halten.
Was bewirken diese, hier kurz skizzierten, allgemeinen Gesetzmäßigkeiten konkret? Zur Veranschaulichung soll das an einem fiktiven Beispiel dargestellt werden: Ein nicht industrialisiertes Land weist eine bedeutende Lagerstätte für einen Rohstoff aus, der für Produkte aus der Hochtechnologie-Branche benötigt wird. Da in diesem Land eine solche nicht existiert, gibt es keinen Eigenbedarf. Gefördert wird der Rohstoff nur wegen der Nachfrage aus den Industrieländern. Der Eigentümer von Bodenschätzen ist in diesen Fall der Staat. Deshalb steht ihm die erwähnte Grundrente (Royaltys) für die Förderungserlaubnis zu. Der Abbau wird von einem internationalen Rohstoffkonzern durchgeführt, der das dazu benötigte Kapital zur Verfügung stellt. Anlagen, Maschinen, Fachkräfte wie Geologen, Ingenieure etc. bringt der Konzern (wie fast immer) aus dem Ausland mit. Für seinen Kapitaleinsatz beansprucht der Konzern mindestens die in dieser Branche übliche Durchschnittsprofitrate. Der erzielte Profit wird (wie meistens) wieder ins Ausland transferiert. Zu fragen ist jetzt noch, ob wegen besonders günstiger Förderbedingungen ein Extraprofit anfällt. Wenn ja, gibt es zwei potentielle Nutznießer, den Konzern oder den Staat. Wer sich einen Extraprofit letztlich aneignen kann, oder in welchem Verhältnis eine Teilung erfolgt, hängt vom Durchsetzungsvermögen der Beteiligten ab, ist also eine Machtfrage. Weiter ist zu fragen, wie mit negativen Folgen des Abbaus, z.B. Abholzen von Wald, Einsatz von Chemikalien, Abraum umgegangen wird? Wurde das Abbaugebiet bisher landwirtschaftlich genutzt, gibt es Entschädigungen für die Betroffenen und ähnliches mehr? Realistisch gesehen ergibt das oft folgendes Bild. Das Land erzielt zwar Deviseneinnahmen aus dem Export des Rohstoffs. Aber ein großer Teil der Einnahmen muss wieder für Importe ausgegeben werden, um den Abbau zu ermöglichen, bzw. fließt als Gewinn wieder ins Ausland. Im Lande bleibt nur relativ wenig, im Wesentlichen die meistens nicht allzu hohen Gebühren an den Staat und die Lohnzahlungen für die eher wenig qualifizierten Arbeiten, für die Einheimische herangezogen werden. Beim Staat ist dann noch zu fragen, wem seine Einnahmen wirklich zugute kommen oder ob eventuell nur eine kleine Schicht davon profitiert (aber das wäre eine andere Geschichte).
Die Tatsache, dass der Rohstoff für immer abgebaut wird und in der Zukunft, wenn eventuell Eigenbedarf gegeben wäre, dem Land nicht mehr zur Verfügung steht, wird nicht speziell vergolten. Ebenso wenig geht in die Kalkulation ein, dass der Rohstoff auch global gesehen ein relatives seltenes Gut sein kann. Entscheidend ist nur, ob genügend Nachfrage zu erwarten ist, um den Abbau, inklusive aller getätigten Investitionen, profitabel zu betreiben. Das beinhaltet meistens nur eine mittelfristige Perspektive.
Wenn das Land mit den Rohstoffvorkommen ein entwickeltes Industrieland (etwa Kanada oder Australien) wäre, gäbe das keine prinzipiellen, sondern nur mehr oder weniger bedeutende graduelle Unterschiede zu diesem fiktiven Beispiel. So könnte z.B. ein Eigenbedarf für den Rohstoff gegeben sein, der Konzern, der den Abbau durchführt, könnte einheimisch sein, Anlagen und Maschinen könnten eventuell aus einer Produktion im Lande stammen und auch das qualifizierte Personal könnte wahrscheinlich leichter lokal rekrutiert werden. Alles zusammen, die ökonomischen Auswirkungen des Rohstoffabbaus können sich, müssen sich aber nicht, unterscheiden. Aber der Aspekt des Zugriffs auf die Natur, oder deren Ausbeutung und die Tatsache der Endlichkeit von Rohstoffen, Aspekte, die für die Degrowth Szene sehr wichtig sind, wären genauso gegeben. Die kapitalistische Ökonomie hat für die Frage, wie mit der Endlichkeit von Rohstoffen umgegangen werden soll, kein Konzept und schon gar keine Lösung. Es handelt sich um ein Problem, das offensichtlich nach einer übergeordneten Planung verlangt. Nur so könnte ein einigermaßen sinnvoller Umgang mit einem zwar nicht in der Gegenwart aber in der Perspektive knappen Stoff gefunden werden. Aber eine solche Planung widerspricht fundamental dem Kapitalismus und dem Interesse der Kapitalisten.
So etwas wie eine Mengensteuerung im Kapitalismus könnte höchstens durch eine Monopolisierung zustande kommen. Das würde voraussetzen, dass der Monopolist, eventuell ein Staat oder eine Gruppe von Staaten, die Kontrolle über einen großen Teil der Vorkommen erlangt hat und diese auch gegenüber anderen Interessenten behaupten kann, eventuell auch mit militärischen Mitteln. Aber auch dann wäre das treibende Interesse vermutlich eher die Maximierung der eigenen Einnahmen oder die Sicherstellung der eigenen Versorgung (oder der Ausschluss verfeindeter Konkurrenten) und weniger ökologische Fragen oder ein nachhaltiger Ressourcenumgang.
Ausbeutung: Aneignung von Mehrwert oder ungleicher Tausch
Genauso häufig wie von Ausbeutung der Natur ist in den einschlägigen Publikationen von der Ausbeutung des Menschen die Rede. Allgemeiner Konsens ist Kritik an allen Ausbeutungsverhältnisse und die Forderung, diese abzuschaffen. Weniger eindeutig ist meistens die Analyse solcher Verhältnisse, wer wen ausbeutet und aufgrund welcher ökonomischen und sonstigen Bedingungen. Meistens fehlt auch eine genauere Untersuchung der Klassenlage und dementsprechend auch eine fundierte Aussage darüber, wer der Hauptadressat sein könnte, wenn es nicht nur um eine generelle Anprangerung, sondern um eine Mobilisierung gegen die Ausbeutungsverhältnisse geht. Häufig findet man Passagen, die suggerieren, der Nutznießer von miserablen Arbeitsbedingungen und geringen Löhne sei vor allem die Käufer_in und Konsument_in von Billigprodukten. Außerdem wird immer wieder die These vertreten, der Wohlstand in den Zentren erkläre sich wesentlich aus Wertübertragungen aus der Peripherie. Auch hier meistens ohne ausführliche ökonomische Analysen. Der historische Wandel, den es im Verhältnis Zentren und Peripherie, und damit auch bei den Ausbeutungsverhältnissen, gegeben hat, wird oft nicht ausreichend berücksichtigt, d. h.historische Tatsachen werden nicht klar genug von jetzigen (und auch für die nahe Zukunft relevanten) Verhältnissen unterschieden. Ebenso wird viel zu selten die Klassenlage in den Zentren einbezogen.
Im Kapitalismus ist davon auszugehen, dass das grundlegende ökonomische Verhältnis der Tausch von Äquivalenten ist. Der Kapitalismus und die typische kapitalistische Ausbeutung basiert also nicht auf simplen Raub oder Betrug. Es ist das Verdienst von Marx, die entsprechenden Mechanismen analysiert und aufgedeckt zu haben, z.B. wie durch die Fähigkeit der Arbeitskraft, Wert zu produzieren, Mehrwert entsteht, der abgeschöpft werden kann, also Ausbeutung stattfindet, ohne dass gegen das Prinzip vom Äquivalententausch verstoßen wird. Das festzuhalten bedeutet aber selbstverständlich nicht, dass es Raub und Betrug nicht gab und gibt. Ebenso wenig ist ungleicher Tausch, bei dem eben nicht Äquivalente getauscht werden, vollkommen ausgeschlossen. Wenn man aber in einem entwickelten kapitalistischen System von ungleichen Tausch im großen Stil ausgeht, wird man eine Begründung finden müssen, warum hier vom kapitalistischen Grundprinzip abgewichen wird.
Aus der Aufdeckung des Mehrwerts als Quelle des Profits folgt auch, dass Ausbeutung zwischen Kapital und Arbeit stattfindet, die Kapitalist_in eignet sich den von den Arbeitern produzierten Mehrwert an. Die Käufer_in von Waren, die Konsument_in, muss dagegen normalerweise einen Preis bezahlen, der mehr oder weniger dem Wert der Waren entspricht, denn der Marktpreis schwankt gemäß Angebot und Nachfrage um den Wert der Waren. Die Käufer_in steht also nicht im Mittelpunkt des Ausbeutungsgeschehens.
So weit die grundlegenden Überlegungen. Es sei daran erinnert, dass diese einen entfalteten Kapitalismus und einen relativ homogenen Wirtschaftsraum annehmen und zuerst einmal unter diesen Bedingungen gelten. Beide Bedingungen können, wenn das Verhältnis Zentren Peripherie untersucht wird, nicht einfach als gegeben vorausgesetzt werden.
Bei einer konkreten Analyse muss man sich mit der stark ungleichen Entwicklung der Länder und Regionen im Weltmaßstab auseinandersetzen. Damit ist man mitten drin in der Frage der ungleichen Entwicklung im Kapitalismus. Bekanntlich wird diese Frage unter den marxistischen Linken schon seit über 100 Jahren diskutiert und das durchaus kontrovers. Der klassische Ansatz ist die Theorie vom Imperialismus. Auch wenn auf der Linken praktisch niemand die Existenz des Imperialismus in Frage stellt, heißt das nicht, dass zu dieser Frage wirklich Einigkeit bestehen würde. Zu vielen Aspekten, ökonomischen und politischen, gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Auf die umfangreiche Literatur zu diesem Thema kann hier nur pauschal verwiesen werden.
Soll die konkrete Analyse auch die Geschichte einbeziehen, wird auch die Entwicklung des Kapitalismus in den Zentren mit seinen verschiedenen Stadien, von den Anfängen bis zum reifen Kapitalismus, relevant. In der Frühphase des Kolonialismus z.B. (auf der Basis eines sich erst herausbildenden, aber noch nicht voll entfalteten Kapitalismus) waren auf offener Gewalt beruhende Ausbeutungssysteme, wie Sklaverei und andere Formen der Zwangsarbeit, Plünderungen und Raub, weit verbreitet. Es ist unstrittig, dass Auswirkungen aus dieser Phase der kolonialen Herrschaft auch heute noch nachwirken, z.B. die destruktiven Folgen des Sklavenhandels in den betroffenen Ländern oder die Konzentration von Reichtum bei den besitzenden Klassen der Zentren. Auch in späteren Phasen wurden wirtschaftliche Interessen der Kolonialmächte häufig basierend auf massiver Macht durchgesetzt. Gut bekannte Beispiele sind z.B. das Vorgehen der Briten beim Textilhandel mit Indien. In der Frühphase (beginnend im 17., bis in das 19. Jahrhundert hinein), als die indische Produktion der englischen noch überlegen war, wurde durch eine strikte Schutzzollpolitik die entstehende Textilindustrie von Konkurrenz abgeschirmt. Später (ab Mitte des 19. Jahrhunderts), als durch die inzwischen erfolgte Mechanisierung die englischen Hersteller günstiger produzieren konnten, wurde Indien ein Freihandelsregime aufgezwungen, mit der Folge des weitgehenden Ruins der dort existierenden (vorkapitalistischen) Produzenten. Ein weiteres Beispiel sind die beiden Opiumkriege (1839-42, 1856-60), durch die Großbritannien (beim zweiten auch Frankreich) China mit militärischer Gewalt zwang, den Import von Opium zuzulassen. (Gleichzeitig konnten sich die Kolonialmächte noch andere Vergünstigungen in China sichern.) Der Grund für das militärische Vorgehen war die ständige negative Handelsbilanz der europäischen Länder mit China und der dadurch bedingte Abfluss von Silber nach China. Die Briten konnten dem zuerst nur das unter ihrer Regie in ihrer Kolonie Bengalen produzierte Opium entgegensetzen, gegen dessen massenhafte Einfuhr sich das chinesische Kaiserreich wehrte. Profitiert von dieser Politik haben die Handelsinteressen der Ost-Indien-Kompanie und das dahinter stehende Kapital, bzw. die Textilkapitalisten, aber bestimmt nicht die britische Arbeiterklasse der damaligen Zeit. Dies ist offensichtlich. Trotzdem ist eine Einschätzung der langfristigen Folgen komplizierter. Denn solche kolonialistischen Aktionen haben die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise begünstigt und beschleunigt. Man kann davon ausgehen, dass die (spätere) Marktüberlegenheit der kapitalistischen Produzenten nicht, oder nicht so eindeutig, oder nicht so schnell zustande gekommen wäre, wenn es eine solche Machtpolitik nicht gegeben hätte.
Aber der Kolonialismus und die damit verknüpfte Gewalt und Ausbeutung ist nur eine Komponente. Es gibt auch andere Faktoren, die für die Entwicklung des Kapitalismus wichtig sind, etwa der Einsatz von Wissenschaft und Technik und die damit zusammenhängende Steigerung der Produktivkräfte. Die permanente Produktivitätssteigerung ist ein wesentliches Element des Kapitalismus und trägt entscheidend zur Produktion von gesellschaftlichen Reichtum (wer immer sich den dann aneignet) bei. Auch für die Konkurrenz der Kapitale untereinander ist die Produktivität ein wichtiges Kriterium, oft das entscheidende. Veränderungen bei der Produktivität können die Erklärung für das Auf und Ab von Einzelkapitalien in der kapitalistischen Konkurrenz oder für deren Stellung auf dem Weltmarkt liefern. Dies trifft auch bei Ländern und Regionen zu, vermittelt über die durchschnittliche Produktivität ihrer Ökonomien.
Die hohe Produktivität, die in den kapitalistischen Zentren erreicht wurde, ist heute eine der Hauptursachen für die manifeste Ungleichheit bei deren Verhältnis zur Peripherie. Gleichzeitig dürfte sie auch die Hauptquelle für den historisch beachtlichen materiellen Wohlstand der arbeitenden Klassen sein, wie er etwa in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg aufgebaut wurde. Etwas vereinfacht kann man feststellen: Wenn ein Durchschnittsverdiener sich ein Auto leisten kann, liegt das in erster Linie daran, dass inzwischen die notwendige Arbeitszeit, die in einem Auto inkorporiert ist, sehr stark gesunken ist (in Vergleich zu früheren Zeiten). Das heißt aber auch, die Werte, die seit der Periode des Fordismus im Rahmen des Massenkonsums von den arbeitenden Klassen konsumiert werden, wurden und werden zum größten Teil auch von ihnen selbst produziert. In der Zeit des Neoliberalismus und der Globalisierung haben sich dabei Verschiebungen ergeben, ohne aber das Gesamtbild grundsätzlich zu verändern.
Wenn Länder oder Wirtschaftsräume mit unterschiedlicher durchschnittlicher Produktivität in einen intensiven Austausch treten, geschieht das für die weniger produktive Seite unter ungünstigen Bedingungen. Denn es bedeutet, dass die zusätzliche Arbeitszeit, die das unproduktive Land mehr im Vergleich zum produktiven aufgewendet hat, aufwenden muss, letztlich einer Entwertung ausgesetzt wird. Denn der Wert von Waren bestimmt sich nicht durch die individuell enthaltene Arbeitszeit, sondern durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Arbeitszeiten, die darüber hinaus in Produkten enthalten sind, tragen nichts zu deren Wert bei, sie werden entwertet. Etwas ähnliches geschieht auch beim internationalen Handel. Wenn sich das Produktivitätsniveau der hochproduktiven Produzenten als Standard für den Handelsaustausch durchsetzt, wird damit so etwas ähnliches wie die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit festgelegt.
Diese Aussage bezieht sich auf das Grundprinzip, das die Waren und die Wirtschaftsräume miteinander in Beziehung treten lässt, ist aber stark vereinfacht. Denn in der Realität geht es meistens nicht um einzelne Produkte. Die entscheidende Größe, die den Austausch steuert, ist die jeweilige durchschnittliche Produktivität der Ökonomien, die im Austausch stehen. Normalerweise tauschen unterschiedliche Wirtschaftsräume auch nicht gleichartige Waren aus, die mit unterschiedlicher Produktivität hergestellt werden, sondern es kommt zu einer Aufspaltung in charakteristische Produktpaletten, die jeweils exportiert bzw. importiert werden, etwa nach dem Muster Maschinen gegen Textilien. In Wirklichkeit vergleichen sich auch nicht Produktivitäten direkt, sondern Preise. Meistens werden die Austauschverhältnisse durch die Wechselkurse der Währungen zum Ausdruck gebracht. Der Kurs der Währung des wenig produktiven Landes ist tief, deshalb erscheinen aus Sicht des produktiven Landes die dortigen Preise und Löhne als niedrig und günstig. Selbstverständlich spielen auch noch eine Reihe von anderen Faktoren, wie etwa Zölle, eine Rolle. Die Wechselkurse wiederum können neben anderen Einflüssen insbesondere der Spekulation ausgesetzt sein, sie spiegeln also keineswegs ausschließlich die unterschiedlichen Produktivitäten wieder.
Im Kern bleibt aber die Feststellung: beim Handel zwischen Ökonomien mit (stark) abweichender durchschnittlicher Produktivität gibt es die Tendenz zur Entwertung der unter den unproduktiven Bedingungen verausgabten Arbeitszeit. Die Entwertung ist nicht das Ergebnis bewusster Handlungen, sie spielt sich hinter dem Rücken der beteiligten Akteure ab. Da auf der einen Seite der am Austausch Beteiligten eine Entwertung stattfindet, werden letztlich gleiche Werte ausgetauscht, die Regel des Äquivalententausch wird nicht verletzt.
Das mehr oder weniger genaue Wissen um diese Umstände ist vermutlich der Grund für die oft vertretene These der Arbeitsübertragungen aus der Peripherie in die Zentren bzw. des Wohlstands auf Kosten der Peripherie. Es ist verständlich, wenn die geschilderten Mechanismen der Entwertung für unfair gehalten werden, auch wenn sie die Regel des Äquivalententausch nicht verletzen. Aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass es sich dabei um einen besonders zentralen Teil der kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten handelt.
Weil immer wieder das Argument Ausbeutung durch Kauf von Billigware auftaucht, soll noch etwas genauer darauf eingegangen werden. Wir haben festgestellt, das Kapital eignet sich den produzierten Mehrwert an. Das kann auch ein komplexer Vorgang sein. Bekanntlich gibt es in der globalen Wirtschaft komplizierte internationale Lieferketten. Damit verbunden stellt sich die Frage, wer sich innerhalb dieser Lieferketten eigentlich den Mehrwert aneignet. Eignet sich jeder formal selbstständige Kapitalist einen Anteil an, der proportional zu der unter seiner Regie erfolgten Wertschöpfung ist? Oder kann es da Verschiebungen geben? Selbstverständlich gibt es Verschiebungen, je nach Marktmacht der Beteiligten und der Konkurrenz untereinander. Ein Beispiel dafür wäre die Produktion und der Handel mit Textilien. Bekanntlich erfolgt deren Produktion meistens nicht in den kapitalistischen Zentren, sondern in anderen Ländern (China, Bangladesch etc.). Es ist auch bekannt, dass für ein Bekleidungsstück, das in Deutschland etwa für 100 € verkauft wird, die produzierenden Firmen nur etwa 10 € oder auch noch weniger erhalten. Der Rest ist Marge für den Handel in den Zentren (wobei selbstverständlich noch Kosten entstehen und nicht alles Gewinn ist). Bei diesem Beispiel verschiebt sich also die Aneignung eines erheblichen Anteils des Mehrwerts von den unmittelbaren Produzenten zu Agenten der Distribution. Ermöglicht wird das hauptsächlich durch die heftige Konkurrenz der Hersteller untereinander und dem Fehlen von eigenen, unter ihrer Kontrolle befindlichen Vertriebswegen in Europa, USA etc.. Dabei ist anzunehmen, dass der Endkunde einen Preis bezahlt, der mehr oder weniger dem Wert entspricht, also im Endpreis keine systematische Abweichung vom Wert festzustellen ist. Ob die Anbieter in Deutschland eine Hochpreis oder Tiefpreis Strategie verfolgen oder mit zwei verschiedenen Marken doppelgleisig fahren, ist eine Entscheidung dieser Firmen. Aber beide Strategien profitieren vom derzeitigen Machtgefälle zwischen Distribution und Produktion. Mit den Marktstrategien der Distributoren muss kein Unterschied bei Löhnen und Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern verbunden sein. Ein öffentlich bekanntes Beispiel ist Apple, das die Endmontage seiner Produkte bei Foxconn in China durchführen lässt. Über die schlechten Arbeitsbedingungen dort gibt es etliche Berichte, aber Apple ist bekanntlich kein Billiganbieter. Selbst wenn die Konsumenten_innen sich von Billigprodukten abwenden würden, bedeutet das keineswegs, dass deswegen die Arbeiter_innen in den Produzentenländern bessere Löhne bekämen, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern würden oder dass sich generell die wirtschaftlichen Machtverhältnisse dort verändern würden. Solche Hoffnungen zu haben, wäre illusionär und würde die tatsächlichen Gründe für Macht und Ausbeutung verkennen.
Die Gesellschaften in den Zentren und in der Peripherie sind heute in vielfältiger Weise gespalten. Die Ungleichheit und soziale Spaltung in den Industrieländern hat in den letzten Jahrzehnten weiter zugenommen. In den Ländern der Peripherie stehen herrschende und privilegierte Klassen und Schichten der breiten Bevölkerung entgegen. Dazu kommen noch, zumindest in einigen Ländern, aufstrebende Mittelschichten, deren Interessen sich ebenso von denen der großen Mehrheit der Bevölkerung als auch der Oberschicht unterscheiden können. Diese doppelte Spaltung in Zentren und Peripherie ist auch der Degrowth Bewegung bewusst, zumindest den kapitalismuskritischen Teilen. In der derzeitigen Weltlage häufen sich auch für die Zentren und den dort herrschenden Klassen die Schwierigkeiten und Krisen. Seit geraumer Zeit funktioniert die Kapitalakkumulation nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher der Fall war. Daran haben auch die sogenannten neoliberalen „Reformen“ prinzipiell nichts geändert.
Neben den ökonomisch-sozialen Widersprüchen machen sich die Auswirkungen der ökologischen Krise immer dringlicher bemerkbar. Die ökonomische und ökologische Lage ist natürlich vielfältig miteinander verschränkt. Aber die direkt betroffenen sind oft nicht die gleichen und die, die sich in der einen oder anderen Sache engagieren, auch nicht. Daraus ergibt sich die Gefahr von Spaltungen und des Auseinanderdividieren von Widerstandsbewegungen. Das sollte jedem bewusst sein. Es ist für alle kritischen und auf Veränderung setzenden Kräfte eine wichtige und vielleicht sogar die entscheidende Frage, wie solche Spaltungen vermieden werden können bzw. wie gegebenenfalls mit ihnen umgegangen wird.
Krisen und Probleme gibt es genug. Aber die politischen Auswirkungen sind noch relativ gering. Noch gibt es bei vielen die Hoffnung auf „Selbstheilungskräfte“ oder darauf mit begrenzten Maßnahmen zu Lösungen zu kommen. Viele Gegenbewegungen sind schwach, insbesondere wenn sie grundsätzliche Fragen stellen. Andere sind national begrenzt und/oder von widersprüchlichem Bewusstsein geprägt. Ein Teil der Widersprüche äußert sich auch in einem populistischen und rechten Fahrwasser. Gemeinsame Interessen aller arbeitenden bzw. lohnabhängigen Klassen lassen sich zwar analytisch herausarbeiten, auch global gesehen. Aber die unmittelbaren Erfahrungen und die praktischen Politikansätze können noch sehr unterschiedlich sein und drängen noch nicht zu einer wirksamen Zusammenarbeit.
Den Motor für eine fundamentale Umgestaltung der bestehenden Gesellschaft sehen Marxisten im verschärften Klassenkampf. Traditionell gehen Marxisten davon aus, dass dieser durch soziale Widersprüche angetrieben wird, insbesondere durch Konflikte, wie sie in den Betrieben in direkter Konfrontation mit dem Kapital erfahren werden.
Niemand kann vorhersehen, wo, wie und wann sich die Widersprüche in der Zukunft weiter zuspitzen werden und welche Bewegungen und Kämpfe daraus entstehen. Aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass die ökologische Probleme dabei eine sehr wichtige Rolle spielen werden und eventuell die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen dominieren. Auch die ökologischen Probleme lassen sich als Folgen der kapitalistischen Widersprüche charakterisieren, wenn auch dieser Zusammenhang nicht immer offensichtlich ist und Kämpfe nicht unmittelbar zu einer Konfrontation Arbeit gegen Kapital führen. Für die nähere Zukunft ist damit zu rechnen, dass der Klimawandel als besonders dringlich angesehen wird. Kurzfristig gesehen geht es dabei noch keineswegs um Systemfragen. Unmittelbar kommt es darauf an, den CO2 Ausstoß signifikant zu senken. Für entsprechende Maßnahmen gibt es verschiedene Vorschläge, die mehr oder weniger mit dem Kapitalismus vereinbar sind. Wirkliche Realisierungschancen haben vermutlich nur die mit dem Kapitalismus kompatiblen Vorschläge. Zumal ein Teil der herrschenden Klassen die Wichtigkeit der Aufgabe erkannt hat und bereit zu sein scheint, dabei mitzuwirken. Ob die Reduktion des CO2 Ausstoß im globalen Maßstab gelingt, so wie es nötig wäre, ist offen, genauso wie die klimatischen und politischen Folgen bei einem Scheitern. Aufgabe von Marxisten ist es, darauf hinzuwirken, falsche Frontstellungen zu vermeiden und eine klare Analyse aller Krisenursachen zu betreiben, seien sie ökonomischer, sozialer oder ökologischer Art. Insbesondere ist es die Aufgabe von Marxisten, die Klassenzusammenhänge aufzudecken und in den Debatten und Kämpfen zu thematisieren.
- Wer sich dafür näher interessiert, dem sei folgendes Buch empfohlen: Kohei Saito, Natur gegen Kapital. Marx` Ökologie in seiner unvollendeten Kritik des Kapitalismus, Campus Verlag, Frankfurt 2016↑

Hinterlasse jetzt einen Kommentar